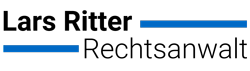Freistellung im Arbeitsrecht – Rechte, Pflichten und Fallstricke
Freistellung im Arbeitsrecht – Rechte, Pflichten und Fallstricke
Die Freistellung ist die vorübergehende Entbindung des Arbeitnehmers von der Pflicht zur Arbeitsleistung – das Arbeitsverhältnis selbst bleibt aber bestehen. In der Praxis wird sie häufig einseitig vom Arbeitgeber erklärt, insbesondere nach einer Kündigung.
Arten der Freistellung
➡️ Einvernehmliche Freistellung
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren gemeinsam, dass der Arbeitnehmer vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr arbeiten muss.
➡️ Einseitige Freistellung
Der Arbeitgeber erklärt allein, dass der Arbeitnehmer nicht mehr zur Arbeit erscheinen muss. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig – insbesondere, wenn das Unternehmen weiterhin die vereinbarte Vergütung zahlt.
Voraussetzungen für eine einseitige Freistellung
Eine einseitige Freistellung ist rechtlich nur zulässig, wenn:
- ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers vorliegt (z. B. Schutz von Betriebsinterna),
- der Arbeitnehmer weiterhin voll bezahlt wird,
- und der Beschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers nicht überwiegt.
Häufig erfolgt die Freistellung im Zusammenhang mit einer Kündigung, um Spannungen oder Störungen im Betrieb zu vermeiden.
Beschäftigungsanspruch und Persönlichkeitsrecht
Arbeitnehmer haben grundsätzlich einen Anspruch auf tatsächliche Beschäftigung, der sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 und 2 Grundgesetz) ergibt. Arbeit dient nicht nur dem Einkommen, sondern auch der sozialen Teilhabe.
Eine Freistellung ist deshalb nicht beliebig möglich – insbesondere, wenn keine Kündigung ausgesprochen wurde.
Verrechnung von Urlaub und Überstunden nur bei "unwiderruflicher" Freistellung möglich
Ein wichtiger arbeitsrechtlicher Punkt betrifft die Frage, ob Resturlaubstage oder Überstunden während der Freistellung „verbraucht“ oder vom Arbeitgeber „angerechnet“ werden dürfen.
Die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte geht davon aus, dass dies nur zulässig ist, wenn die Freistellung „unwiderruflich“ erfolgt. Das heißt, dass der Arbeitgeber ausdrücklich erklären muss, dass der Arbeitnehmer dauerhaft nicht mehr zur Arbeit zurückgerufen wird.
Bei einer "widerruflichen" Freistellung – also wenn sich der Arbeitgeber vorbehält, den Arbeitnehmer jederzeit wieder zur Arbeit zu rufen – dürfen weder Urlaubs- noch Überstundenansprüche angerechnet werden.
❗ In einer Kündigungsschutzklage kann es entscheidend sein, ob die Freistellung eindeutig als unwiderruflich bezeichnet wurde – z. B. mit der Formulierung:
„Sie werden unter Anrechnung auf bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche unwiderruflich von der Arbeitsleistung freigestellt.“
Handlungsempfehlungen
✅ Für Arbeitnehmer:
- Klären Sie, ob Ihre Freistellung widerruflich oder unwiderruflich ist – das hat direkte Auswirkungen auf Urlaubsansprüche.
- Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Art und Dauer der Freistellung.
- Lassen Sie die Freistellung im Zweifel rechtlich prüfen, insbesondere dann, wenn diese im Zusammenhang mit einer Kündigung ausgesprochen wird.
✅ Für Arbeitgeber:
- Formulieren Sie klar, ob die Freistellung widerruflich oder unwiderruflich ist.
- Nur bei unwiderruflicher Freistellung dürfen Sie Urlaubs- und Überstundenansprüche verrechnen.
- Dokumentieren Sie die Freistellung schriftlich und fügen Sie sie z. B. dem Kündigungsschreiben bei.
Fazit
Die Freistellung ist ein wirksames arbeitsrechtliches Mittel, muss aber klar geregelt, sauber dokumentiert und rechtlich zulässig sein. Besonders die Unterscheidung zwischen widerruflich und unwiderruflich ist entscheidend – vor allem bei der Anrechnung von Resturlaub und Überstunden. Eine juristische Prüfung ist oft sinnvoll, um Risiken zu vermeiden.
Sie benötigen eine Ersteinschätzung zu Ihrem konkreten Fall - rufen Sie mich an unter 0511 / 261 437‑0 oder schreiben Sie über das Kontaktformular – wir besprechen Ihr Anliegen noch heute unverbindlich.